

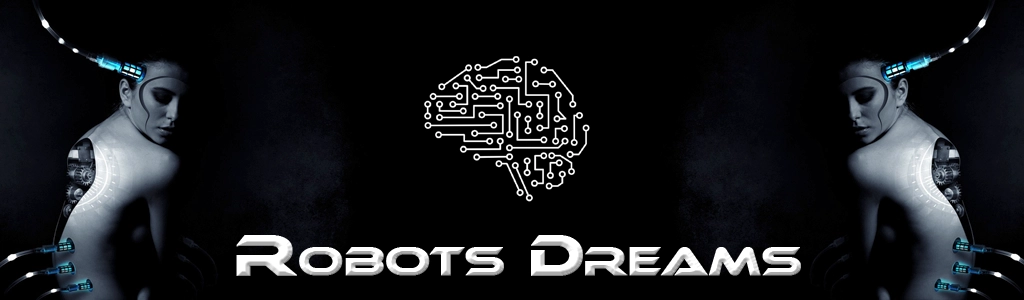
OPcache is a built-in bytecode caching extension for PHP that significantly improves performance by precompiling PHP code and storing it in memory (RAM).
Normally, every PHP request goes through:
Reading the PHP source file
Parsing and compiling it into bytecode
Executing the bytecode
With OPcache, this process happens only once. After the first request, PHP uses the precompiled bytecode from memory, skipping the parsing and compiling steps.
| Benefit | Description |
|---|---|
| ⚡ Faster performance | Eliminates redundant parsing and compiling |
| 🧠 Reduced CPU usage | Lower system load, especially under high traffic |
| 💾 In-memory execution | No need to read PHP files from disk |
| 🛡️ More stable and secure | Reduces risks from dynamically loaded or poorly written code |
php -i | grep opcache.enableOr in code:
phpinfo();📦 Typical Configuration (php.ini)
opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.validate_timestamps=1
opcache.revalidate_freq=2💡 In production, it’s common to set
opcache.validate_timestamps=0— meaning PHP won’t check for file changes on every request. This gives even more performance, but you’ll need to manually reset the cache after code updates.
OPcache is especially helpful for:
Via PHP:
opcache_reset();Or from the command line:
php -r "opcache_reset();"OPcache is a simple but powerful performance booster for any PHP application. It should be enabled in every production environment — it’s free, built-in, and drastically reduces load times and server strain.
Memcached is a distributed in-memory caching system commonly used to speed up web applications. It temporarily stores frequently requested data in RAM to avoid expensive database queries or API calls.
Key-Value Store: Data is stored as key-value pairs.
In-Memory: Runs entirely in RAM, making it extremely fast.
Distributed: Supports multiple servers (clusters) to distribute load.
Simple API: Provides basic operations like set, get, and delete.
Eviction Policy: Uses LRU (Least Recently Used) to remove old data when memory is full.
Caching Database Queries: Reduces load on databases like MySQL or PostgreSQL.
Session Management: Stores user sessions in scalable web applications.
Temporary Data Storage: Useful for API rate limiting or short-lived data caching.
Memcached: Faster for simple key-value caching, scales well horizontally.
Redis: Offers more features like persistence, lists, hashes, sets, and pub/sub messaging.
sudo apt update && sudo apt install memcached
sudo systemctl start memcachedIt can be used with PHP or Python via appropriate libraries.
PSR-6 is a PHP-FIG (PHP Framework Interoperability Group) standard that defines a common interface for caching in PHP applications. This specification, titled "Caching Interface," aims to promote interoperability between caching libraries by providing a standardized API.
Key components of PSR-6 are:
Cache Pool Interface (CacheItemPoolInterface): Represents a collection of cache items. It's responsible for managing, fetching, saving, and deleting cached data.
Cache Item Interface (CacheItemInterface): Represents individual cache items within the pool. Each cache item contains a unique key and stored value and can be set to expire after a specific duration.
Standardized Methods: PSR-6 defines methods like getItem(), hasItem(), save(), and deleteItem() in the pool, and get(), set(), and expiresAt() in the item interface, to streamline caching operations and ensure consistency.
By defining these interfaces, PSR-6 allows developers to easily switch caching libraries or integrate different caching solutions without modifying the application's core logic, making it an essential part of PHP application development for caching standardization.
Write-Around is a caching strategy used in computing systems to optimize the handling of data writes between the main memory and the cache. It focuses on minimizing the potential overhead of updating the cache for certain types of data. The core idea behind write-around is to bypass the cache for write operations, allowing the data to be directly written to the main storage (e.g., disk, database) without being stored in the cache.
Write-around is suitable in scenarios where:
Overall, write-around is a trade-off between maintaining cache efficiency and reducing cache management overhead for certain write operations.
Write-Back (also known as Write-Behind) is a caching strategy where changes are first written only to the cache, and the write to the underlying data store (e.g., database) is deferred until a later time. This approach prioritizes write performance by temporarily storing the changes in the cache and batching or asynchronously writing them to the database.
Write-Back is a caching strategy that temporarily stores changes in the cache and delays writing them to the underlying data store until a later time, often in batches or asynchronously. This approach provides better write performance but comes with risks related to data loss and inconsistency. It is ideal for applications that need high write throughput and can tolerate some level of data inconsistency between cache and persistent storage.
Write-Through is a caching strategy that ensures every change (write operation) to the data is synchronously written to both the cache and the underlying data store (e.g., a database). This ensures that the cache is always consistent with the underlying data source, meaning that a read access to the cache always provides the most up-to-date and consistent data.
Write-Through is a caching strategy that ensures consistency between the cache and data store by performing every change on both storage locations simultaneously. This strategy is particularly useful when consistency and simplicity are more critical than maximizing write speed. However, in scenarios with frequent write operations, the increased latency can become an issue.
Green IT (short for "green information technology") refers to the environmentally friendly and sustainable use of IT resources and technologies. The goal of Green IT is to minimize the ecological footprint of the IT industry while maximizing the efficiency of energy and resource use. It covers the entire lifecycle of IT devices, including their production, operation, and disposal.
The key aspects of Green IT are:
Energy Efficiency: Reducing the power consumption of IT systems such as servers, data centers, networks, and end-user devices.
Extending Device Lifespan: Encouraging the reuse and repair of hardware to decrease the demand for new production and associated resource consumption.
Resource-Efficient Manufacturing: Using environmentally friendly materials and efficient production processes in the manufacturing of IT devices.
Optimization of Data Centers: Leveraging technologies like virtualization, cloud computing, and energy-efficient cooling systems to reduce the power consumption of servers and data centers.
Recycling and Eco-Friendly Disposal: Ensuring that old IT devices are properly recycled or disposed of to minimize environmental impact.
Green IT is part of the broader concept of sustainability in the IT industry and is becoming increasingly important as energy consumption and resource demand grow with the ongoing digitalization and widespread use of technology.
Least Frequently Used (LFU) is a concept in computer science often applied in memory and cache management strategies. It describes a method for managing storage space where the least frequently used data is removed first to make room for new data. Here are some primary applications and details of LFU:
Cache Management: In a cache, space often becomes scarce. LFU is a strategy to decide which data should be removed from the cache when new space is needed. The basic principle is that if the cache is full and a new entry needs to be added, the entry that has been used the least frequently is removed first.
Memory Management in Operating Systems: Operating systems can use LFU to decide which pages should be swapped out from physical memory (RAM) to disk when new memory is needed. The page that has been used the least frequently is considered the least useful and is therefore swapped out first.
Databases: Database management systems (DBMS) can use LFU to optimize access to frequently queried data. Tables or index pages that have been queried the least frequently are removed from memory first to make space for new queries.
LFU can be implemented in various ways, depending on the requirements and complexity. Two common implementations are:
Counters for Each Page: Each page or entry in the cache has a counter that increments each time the page is used. When space is needed, the page with the lowest counter is removed.
Combination of Hash Map and Priority Queue: A hash map stores the addresses of elements, and a priority queue (or min-heap) manages the elements by their usage frequency. This allows efficient management with an average time complexity of O(log n) for access, insertion, and deletion.
While LRU (Least Recently Used) removes data that hasn't been used for the longest time, LFU (Least Frequently Used) removes data that has been used the least frequently. LRU is often simpler to implement and can be more effective in scenarios with cyclical access patterns, whereas LFU is better suited when certain data is needed more frequently over the long term.
In summary, LFU is a proven memory management method that helps optimize system performance by ensuring that the most frequently accessed data remains quickly accessible while less-used data is removed.
Least Recently Used (LRU) is a concept in computer science often used in memory and cache management strategies. It describes a method for managing storage space where the least recently used data is removed first to make room for new data. Here are some primary applications and details of LRU:
Cache Management: In a cache, space often becomes scarce. LRU is a strategy to decide which data should be removed from the cache when new space is needed. The basic principle is that if the cache is full and a new entry needs to be added, the entry that has not been used for the longest time is removed first. This ensures that frequently used data remains in the cache and is quickly accessible.
Memory Management in Operating Systems: Operating systems use LRU to decide which pages should be swapped out from physical memory (RAM) to disk when new memory is needed. The page that has not been used for the longest time is considered the least useful and is therefore swapped out first.
Databases: Database management systems (DBMS) use LRU to optimize access to frequently queried data. Tables or index pages that have not been queried for the longest time are removed from memory first to make space for new queries.
LRU can be implemented in various ways, depending on the requirements and complexity. Two common implementations are:
Linked List: A doubly linked list can be used, where each access to a page moves the page to the front of the list. The page at the end of the list is removed when new space is needed.
Hash Map and Doubly Linked List: This combination provides a more efficient implementation with an average time complexity of O(1) for access, insertion, and deletion. The hash map stores the addresses of the elements, and the doubly linked list manages the order of the elements.
Overall, LRU is a proven and widely used memory management strategy that helps optimize system performance by ensuring that the most frequently accessed data remains quickly accessible.
Time to Live (TTL) is a concept used in various technical contexts to determine the lifespan or validity of data. Here are some primary applications of TTL:
Network Packets: In IP networks, TTL is a field in the header of a packet. It specifies the maximum number of hops (forwardings) a packet can go through before it is discarded. Each time a router forwards a packet, the TTL value is decremented by one. When the value reaches zero, the packet is discarded. This prevents packets from circulating indefinitely in the network.
DNS (Domain Name System): In the DNS context, TTL indicates how long a DNS response can be cached by a DNS resolver before it must be updated. A low TTL value results in DNS data being updated more frequently, which can be useful if the IP addresses of a domain change often. A high TTL value can reduce the load on the DNS server and improve response times since fewer queries need to be made.
Caching: In the web and database world, TTL specifies the validity period of cached data. After the TTL expires, the data must be retrieved anew from the origin server or data source. This helps ensure that users receive up-to-date information while reducing server load through less frequent queries.
In summary, TTL is a method to control the lifespan or validity of data, ensuring that information is regularly updated and preventing outdated data from being stored or forwarded unnecessarily.