

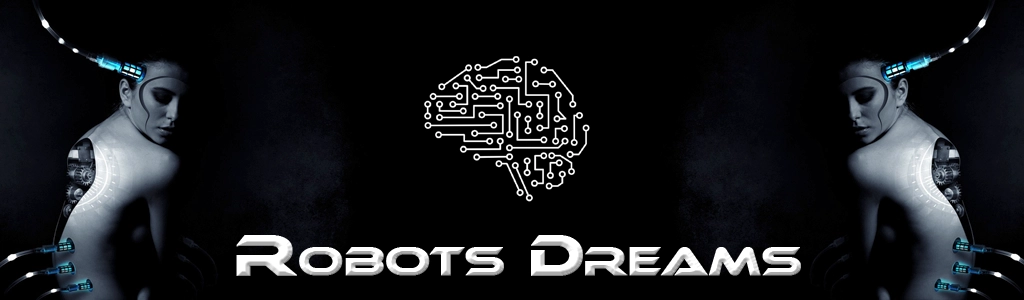
Design by Contract (DbC) is a concept in software development introduced by Bertrand Meyer. It describes a method to ensure the correctness and reliability of software by defining clear "contracts" between different components (e.g., methods, classes).
In DbC, every software component is treated as a contract party with certain obligations and guarantees:
Preconditions
Conditions that must be true before a method or function can execute correctly.
→ Responsibility of the caller.
Postconditions
Conditions that must be true after the execution of a method or function.
→ Responsibility of the method/function.
Invariant (Class Invariant)
Conditions that must always remain true throughout the lifetime of an object.
→ Responsibility of both the method and the caller.
Clear specification of responsibilities.
More robust and testable software.
Errors are detected early (e.g., through contract violations).
class BankAccount {
private double balance;
// Invariant: balance >= 0
void withdraw(double amount) {
// Precondition: amount > 0 && amount <= balance
if (amount <= 0 || amount > balance) throw new IllegalArgumentException();
balance -= amount;
// Postcondition: balance has been reduced by amount
}
}Clear contracts reduce misunderstandings.
Easier debugging, as violations are detected immediately.
Supports defensive programming.
Requires extra effort to define contracts.
Not directly supported by all programming languages (e.g., Java and C++ via assertions, Python with decorators; Eiffel supports DbC natively).
An algorithm is a precise, step-by-step set of instructions used to solve a problem or perform a task. You can think of an algorithm as a recipe that specifies exactly what steps need to be taken and in what order to achieve a specific result.
Key characteristics of an algorithm include:
Algorithms are used in many fields, from mathematics and computer science to everyday tasks like cooking or organizing work processes. In computer science, they are often written in programming languages and executed by computers to solve complex problems or automate processes.
Pseudocode is an informal way of describing an algorithm or a computer program using a structure that is easy for humans to understand. It combines simple, clearly written instructions, often blending natural language with basic programming constructs, without adhering to the syntax of any specific programming language.
IF, ELSE, WHILE, FOR, END, which are common in most programming languages.Here is a simple pseudocode example for an algorithm that checks if a number is even or odd:
BEGIN
Input: Number
IF (Number modulo 2) equals 0 THEN
Output: "Number is even"
ELSE
Output: "Number is odd"
ENDIF
ENDIn this example, simple logical instructions are used to describe the flow of the algorithm without being tied to the specific syntax of any programming language.