

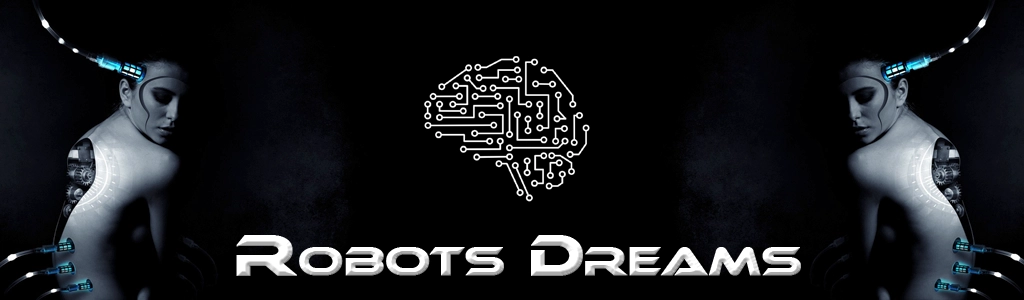
Datenbank-Trigger (kurz: Trigger) sind spezielle automatische Aktionen in einer Datenbank, die ausgelöst werden, wenn bestimmte Ereignisse auf einer Tabelle oder Sicht (View) passieren.
Ein Trigger ist ein vordefinierter Code, der bei INSERT, UPDATE oder DELETE auf einer Tabelle automatisch ausgeführt wird – ohne dass der Benutzer ihn direkt aufruft.
Stell dir vor, du hast eine Tabelle Bestellungen, und du willst, dass immer, wenn eine Bestellung gelöscht wird, diese Info in einer Tabelle Log gespeichert wird.
Dann schreibst du einen DELETE-Trigger für die Tabelle Bestellungen, der automatisch beim Löschen etwas in Log schreibt.
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| BEFORE | Wird vor der Aktion ausgeführt |
| AFTER | Wird nach der Aktion ausgeführt |
| INSTEAD OF | (bei Views) ersetzt die Aktion komplett |
CREATE TRIGGER log_delete
AFTER DELETE ON Bestellungen
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO Log (aktion, zeitpunkt)
VALUES ('Bestellung gelöscht', NOW());
END;Validierung von Daten
Automatisches Logging
Business-Logik abbilden
Referentielle Integrität erweitern
Schwer zu debuggen
Können unbemerkt viele Aktionen auslösen
Beeinflussen Performance, wenn komplex
Ein objektorientiertes Datenbanksystem (OODBMS) ist ein Datenbanksystem, das die Prinzipien der objektorientierten Programmierung (OOP) mit den Funktionalitäten einer Datenbank kombiniert. Es ermöglicht das Speichern, Abrufen und Verwalten von Daten in Form von Objekten, wie sie in objektorientierten Programmiersprachen (z. B. Java, Python oder C++) definiert werden.
Objektmodell:
Klassen und Vererbung:
Kapselung:
Persistenz:
Identität:
Komplexe Datentypen:
Objektorientierte Datenbanken sind besonders nützlich, wenn es darum geht, mit komplexen, hierarchischen oder verschachtelten Datenstrukturen zu arbeiten, wie sie in vielen modernen Softwareprojekten vorkommen.
Die Data Definition Language (DDL) ist ein Bestandteil von SQL (Structured Query Language) und umfasst Befehle, die zur Definition und Verwaltung der Struktur einer Datenbank verwendet werden. DDL-Befehle ändern die Metadaten einer Datenbank, also Informationen über Tabellen, Indizes, Schemata und andere Datenbankobjekte, anstatt die eigentlichen Daten zu manipulieren.
1. CREATE
Wird verwendet, um neue Datenbankobjekte wie Tabellen, Schemata, Views oder Indizes zu erstellen.
Beispiel:
CREATE TABLE Kunden (
ID INT PRIMARY KEY,
Name VARCHAR(50),
Alter INT
);2. ALTER
Dient zur Änderung der Struktur von existierenden Objekten, z. B. Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Beispiel:
ALTER TABLE Kunden ADD Email VARCHAR(100);3. DROP
Entfernt ein Datenbankobjekt (z. B. eine Tabelle) dauerhaft.
Beispiel:
DROP TABLE Kunden;4. TRUNCATE
Löscht alle Daten aus einer Tabelle, behält jedoch die Struktur der Tabelle bei. Es ist schneller als ein DELETE, da keine Transaktionsprotokolle erstellt werden.
Beispiel:
TRUNCATE TABLE Kunden;DDL ist essenziell für das Design und die Verwaltung einer Datenbank und wird meist zu Beginn eines Projekts oder bei strukturellen Änderungen verwendet.
Write-Back (auch als Write-Behind bezeichnet) ist eine Caching-Strategie, bei der Änderungen zuerst nur im Cache gespeichert werden und das Schreiben in den zugrunde liegenden Datenspeicher (z. B. Datenbank) auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Diese Strategie priorisiert die Schreibperformance, indem die Änderungen vorübergehend im Cache gehalten und später in einem Batch oder asynchron an die Datenbank übergeben werden.
Write-Back ist eine Caching-Strategie, die Änderungen zunächst im Cache speichert und das Schreiben in den zugrunde liegenden Datenspeicher auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt, oft in Batches oder asynchron. Diese Methode bietet eine höhere Schreibperformance, birgt aber Risiken wie Datenverlust und Inkonsistenzen. Sie ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Schreiblast haben und mit einer gewissen Inkonsistenz zwischen Cache und persistentem Speicher leben können.
Write-Through ist eine Caching-Strategie, die sicherstellt, dass jede Änderung (Schreiboperation) an den Daten synchron sowohl in den Cache als auch im ursprünglichen Datenspeicher (z. B. Datenbank) geschrieben wird. Dadurch bleibt der Cache immer konsistent mit der zugrunde liegenden Datenquelle. Das bedeutet, dass ein Lesezugriff auf den Cache stets die aktuellsten und konsistenten Daten liefert.
Write-Through ist eine Caching-Strategie, die die Konsistenz von Cache und Datenspeicher sicherstellt, indem sie jede Änderung in beiden Speicherorten gleichzeitig durchführt. Diese Strategie ist besonders nützlich, wenn Konsistenz und Einfachheit wichtiger sind als maximale Schreibgeschwindigkeit. In Szenarien, in denen häufige Schreiboperationen vorkommen, kann jedoch die erhöhte Latenz problematisch sein.
Ein Batch bezeichnet in der Informatik und Datenverarbeitung eine Gruppe oder einen Stapel von Aufgaben, Daten oder Prozessen, die gemeinsam und in einem Durchlauf verarbeitet werden. Es handelt sich um eine gesammelte Menge von Einheiten (z. B. Dateien, Aufträgen oder Transaktionen), die als ein Paket bearbeitet werden, anstatt jede Einheit einzeln und sofort zu verarbeiten.
Hier sind einige typische Merkmale eines Batches:
Sammlung von Aufgaben: Mehrere Aufgaben oder Daten werden gesammelt und dann gemeinsam verarbeitet.
Einheitliche Verarbeitung: Alle Aufgaben im Batch durchlaufen denselben Prozess oder werden auf die gleiche Weise verarbeitet.
Automatische Ausführung: Ein Batch wird oft zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bei Erreichen bestimmter Kriterien automatisch gestartet, ohne menschliches Eingreifen.
Beispiele:
Ein Batch dient der Effizienzsteigerung, indem Aufgaben gebündelt und gemeinsam bearbeitet werden, oft zu Zeiten, in denen das System weniger ausgelastet ist, wie nachts.
Batch Processing ist eine Methode in der Datenverarbeitung, bei der eine Gruppe von Aufgaben oder Daten als "Batch" (Stapel) gesammelt und anschließend gemeinsam verarbeitet wird, anstatt sie einzeln in Echtzeit zu bearbeiten. Diese Methode wird häufig verwendet, um große Mengen von Daten effizient zu verarbeiten, ohne dass menschliches Eingreifen notwendig ist, während der Prozess läuft.
Hier sind einige Merkmale von Batch Processing:
Zeitgesteuert: Die Aufgaben werden zu bestimmten Zeiten oder nach dem Erreichen bestimmter Datenmengen ausgeführt.
Automatisiert: Die Verarbeitung erfolgt in der Regel automatisiert und erfordert kein sofortiges Eingreifen.
Effizient: Da viele Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden, kann Batch Processing Ressourcen und Zeit sparen.
Beispiele:
Es eignet sich besonders für repetitive Aufgaben, die nicht sofort bearbeitet werden müssen, sondern in regelmäßigen Abständen erledigt werden können.
Eine Entity ist ein zentrales Konzept im Bereich der Softwareentwicklung, insbesondere im Domain-Driven Design (DDD). Es beschreibt ein Objekt oder einen Datensatz, der eine eindeutige Identität besitzt und im Laufe der Zeit seinen Zustand ändern kann. Die Identität einer Entity bleibt dabei immer bestehen, unabhängig davon, wie sich die Eigenschaften der Entity verändern.
Eindeutige Identität: Jede Entity hat eine eindeutige Kennung (z.B. eine ID), die sie von anderen Entities unterscheidet. Diese Identität ist das primäre Unterscheidungsmerkmal und bleibt über den gesamten Lebenszyklus der Entity gleich.
Veränderlicher Zustand: Im Gegensatz zu einem Value Object kann sich der Zustand einer Entity ändern. Zum Beispiel können sich die Eigenschaften eines Kunden (Name, Adresse) ändern, aber der Kunde bleibt durch seine Identität immer derselbe.
Geschäftslogik: Entities enthalten oft Geschäftslogik, die mit ihrem Verhalten und Zustand in der Domäne zusammenhängt.
Stellen wir uns eine Kunden-Entity in einem E-Commerce-System vor. Diese Entity könnte folgende Eigenschaften haben:
Wenn sich die Adresse oder der Name des Kunden ändert, bleibt die Entity durch ihre ID immer derselbe Kunde. Das ist der wesentliche Unterschied zu einem Value Object, das keine dauerhafte Identität hat.
Entities werden oft in Datenbanken durch Tabellen abgebildet, wobei die eindeutige Identität in Form eines Primärschlüssels gespeichert wird. In einem Objektmodell einer Programmiersprache wird die Entity durch eine Klasse oder ein Objekt dargestellt, das die Logik und den Zustand dieser Entität verwaltet.
Redundanz in der Softwareentwicklung bezieht sich auf die bewusste Wiederholung oder Duplizierung von Komponenten, Daten oder Funktionen innerhalb eines Systems, um die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Fehlertoleranz zu erhöhen. Redundanz kann auf verschiedene Arten implementiert werden und dient oft dazu, den Ausfall eines Teils eines Systems zu kompensieren und so die Gesamtfunktionalität des Systems zu gewährleisten.
Code-Redundanz:
Daten-Redundanz:
System-Redundanz:
Netzwerk-Redundanz:
In einem Cloud-Service könnte ein Unternehmen mehrere Server-Cluster an verschiedenen geografischen Standorten betreiben. Diese Redundanz sorgt dafür, dass der Dienst auch dann verfügbar bleibt, wenn ein ganzer Cluster aufgrund eines Stromausfalls oder eines Netzwerkausfalls offline geht.
Redundanz ist eine Schlüsselkomponente in der Softwareentwicklung und -architektur, insbesondere in sicherheitskritischen oder hochverfügbaren Systemen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Zuverlässigkeit und Effizienz zu finden, indem man die richtigen Redundanzmaßnahmen implementiert, um das Risiko von Ausfällen zu minimieren.
Ein Release-Artifact ist ein spezifisches Build- oder Paket einer Software, das als Ergebnis eines Build-Prozesses erzeugt wird und zur Verteilung oder Bereitstellung bereit ist. Diese Artifacts sind die endgültigen Produkte, die bereitgestellt und verwendet werden können, und enthalten alle notwendigen Komponenten und Dateien, die für die Ausführung der Software erforderlich sind.
Hier sind einige wichtige Aspekte von Release-Artifacts:
Bestandteile: Ein Release-Artifact kann ausführbare Dateien, Bibliotheken, Konfigurationsdateien, Skripte, Dokumentationen und andere Ressourcen umfassen, die für die Ausführung der Software notwendig sind.
Formate: Release-Artifacts können in verschiedenen Formaten vorliegen, abhängig von der Art der Software und der Zielplattform. Beispiele sind:
Versionsnummerierung: Release-Artifacts sind normalerweise versioniert, um klar zwischen verschiedenen Versionen der Software zu unterscheiden und die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Repository und Verteilung: Release-Artifacts werden oft in Artefakt-Repositories wie JFrog Artifactory, Nexus Repository, oder Docker Hub gespeichert, wo sie versioniert und verwaltet werden können. Diese Repositories ermöglichen es, die Artifacts einfach zu verteilen und in verschiedenen Umgebungen bereitzustellen.
CI/CD Pipelines: In modernen Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) Pipelines ist das Erstellen und Verwalten von Release-Artifacts ein zentraler Bestandteil. Nach erfolgreichem Abschluss aller Tests und Qualitätssicherungsmaßnahmen werden die Artifacts erzeugt und zur Bereitstellung vorbereitet.
Integrität und Sicherheit: Release-Artifacts werden häufig mit Checksummen und digitalen Signaturen versehen, um ihre Integrität und Authentizität sicherzustellen. Dies verhindert, dass die Artifacts während der Verteilung oder Speicherung manipuliert werden.
Ein typischer Workflow könnte folgendermaßen aussehen:
Zusammengefasst sind Release-Artifacts die fertigen Softwarepakete, die nach dem Build- und Testprozess bereit sind, um in Produktionsumgebungen eingesetzt zu werden. Sie spielen eine zentrale Rolle im Software-Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess.