

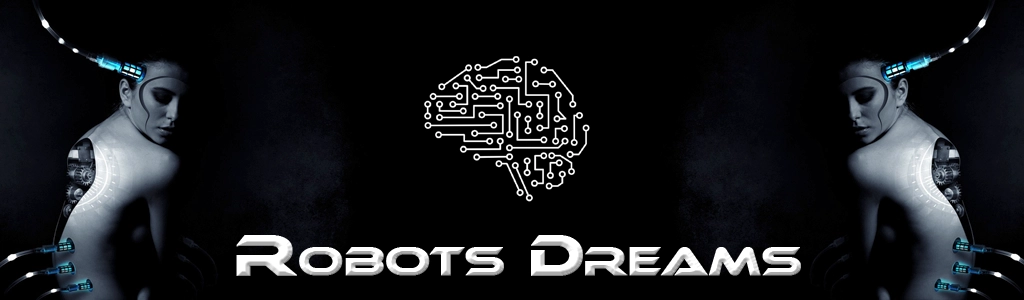
GitHub Actions ist ein Feature von GitHub, mit dem du automatisierte Workflows für deine Softwareprojekte erstellen kannst – direkt im GitHub-Repository.
Du kannst CI/CD-Pipelines (Continuous Integration / Continuous Deployment) aufbauen, z. B.:
🛠️ Code bei jedem Push oder Pull Request builden
🚀 Software automatisch deployen (z. B. auf einen Webserver, in die Cloud, zu DockerHub)
📦 Releases erstellen (z. B. ZIP-Dateien, Versionstags)
🔄 Cronjobs oder geplante Tasks laufen lassen
GitHub Actions basiert auf sogenannten Workflows, die du in einer Datei definierst:
Die Datei heißt z. B. .github/workflows/ci.yml
Sie ist im YAML-Format
Du definierst Events (z. B. push, pull_request) und Jobs (z. B. build, test)
Jobs bestehen aus Steps, die Befehle oder Aktionen ausführen
name: CI
on: [push]
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v3
- uses: actions/setup-node@v3
with:
node-version: '20'
- run: npm install
- run: npm testEine Action ist ein einzelner Schritt, den man in einem Workflow ausführt. Es gibt:
Vorgefertigte Actions (z. B. actions/checkout, setup-node, upload-artifact)
Eigene Actions (z. B. Shell-Skripte oder Docker-Container)
Du kannst Actions im GitHub Marketplace finden und nutzen.
Spart manuelle Arbeit
Verbessert Codequalität (durch automatisierte Tests)
Macht Deployments reproduzierbar
Alles direkt in GitHub – kein externer CI-Dienst nötig (wie Jenkins oder Travis CI)
SonarQube ist ein Open-Source-Tool zur kontinuierlichen Analyse und Qualitätssicherung von Quellcode. Es hilft Entwicklern und Teams, die Codequalität zu bewerten, Schwachstellen zu identifizieren und Best Practices in der Softwareentwicklung zu fördern.
Codequalität prüfen:
Sicherheitslücken aufdecken:
Technische Schulden bewerten:
Unterstützung für viele Programmiersprachen:
Berichte und Dashboards:
SonarQube ist in einer kostenlosen Community-Edition und in kommerziellen Versionen mit erweiterten Funktionen verfügbar (z. B. für größere Teams oder spezielle Sicherheitsanalysen).
Churn PHP ist ein Tool, das dabei hilft, potenziell riskante oder wartungsintensive Teile in einem PHP-Code zu identifizieren. Es analysiert, wie oft Klassen oder Funktionen geändert wurden (Churn-Rate) und wie komplex sie sind (zyklomatische Komplexität). Das Hauptziel besteht darin, Bereiche im Code zu finden, die sich häufig ändern und schwer zu warten sind, was darauf hinweist, dass sie von einer Überarbeitung profitieren könnten oder genauere Aufmerksamkeit benötigen.
Kurz gesagt, Churn PHP hilft Entwicklern, technischen Schulden vorzubeugen, indem es problematische Codebereiche markiert, die in Zukunft potenziell Probleme verursachen könnten. Es lässt sich gut in Git-Repositories integrieren und kann als Teil einer CI/CD-Pipeline ausgeführt werden.
PHP_CodeSniffer (oft kurz „Codesniffer“ genannt) ist ein Tool, das zur Analyse und Durchsetzung von Coding-Standards in PHP-Code verwendet wird. Es überprüft PHP-Dateien auf Einhaltung bestimmter Regeln und sorgt dafür, dass der Code konsistent und gut strukturiert ist. Codesniffer kann in Projekten genutzt werden, um sicherzustellen, dass alle Entwickler einheitlich programmieren und vorgegebene Standards einhalten, was die Wartbarkeit und Qualität des Codes verbessert.
Durch die Verwendung von PHP_CodeSniffer bleibt der Code konsistent und qualitativ hochwertig, was langfristig die Wartbarkeit eines Projekts deutlich erhöht.
Deptrac ist ein statisches Analysewerkzeug für PHP-Anwendungen, das dabei hilft, architektonische Regeln in einem Codebase durchzusetzen. Es analysiert die Abhängigkeiten eines Projekts und überprüft, ob diese den festgelegten architektonischen Vorgaben entsprechen. Das Hauptziel von Deptrac ist es, zu verhindern, dass verschiedene Komponenten zu eng miteinander gekoppelt werden, und somit eine klare, wartbare Struktur zu gewährleisten, besonders in größeren oder wachsenden Projekten.
Deptrac ist besonders nützlich, um Entkopplung und Modularität sicherzustellen, was in skalierenden und umgestaltenden Projekten entscheidend ist. Durch das frühzeitige Erkennen architektonischer Verstöße trägt es dazu bei, technische Schulden zu vermeiden.
Dev Space ist eine cloudbasierte Entwicklungsumgebung, die es Entwicklern ermöglicht, vollständig konfigurierbare Arbeitsbereiche für Softwareentwicklung direkt in der Cloud zu erstellen und zu nutzen. Sie bietet Tools und Ressourcen, um eine Entwicklungsumgebung bereitzustellen, ohne dass man lokal Software installieren oder konfigurieren muss.
Dev Space bietet eine moderne Lösung für Entwicklerteams, die flexibel und ortsunabhängig arbeiten möchten, ohne die Komplexität der lokalen Einrichtung und Wartung von Entwicklungsumgebungen.
Exakat ist ein statisches Analyse-Tool für PHP, das speziell entwickelt wurde, um die Codequalität zu verbessern und Best Practices in PHP-Projekten sicherzustellen. Ähnlich wie Psalm konzentriert es sich auf die Analyse von PHP-Code, bietet jedoch einige einzigartige Funktionen und Analysen, um Entwicklern zu helfen, Fehler zu erkennen und ihre Anwendungen effizienter und sicherer zu machen.
Hier sind einige der Hauptfunktionen von Exakat:
Exakat kann als eigenständiges Tool oder in eine Continuous Integration (CI)-Pipeline integriert werden, um sicherzustellen, dass Code kontinuierlich auf Qualität und Sicherheit überprüft wird. Es ist ein vielseitiges Werkzeug für PHP-Entwickler, die ihren Code verbessern und auf einem hohen Standard halten möchten.
Psalm ist ein PHP Static Analysis Tool, das speziell für PHP-Anwendungen entwickelt wurde. Es hilft Entwicklern dabei, Fehler im Code frühzeitig zu erkennen, indem es den Code statisch analysiert.
Hier sind einige Funktionen von Psalm in der Softwareentwicklung:
Zusammengefasst ist Psalm ein nützliches Werkzeug für PHP-Entwickler, um robusteren, sichereren und besser getesteten Code zu schreiben.
Rolling Deployment ist eine Methode zur schrittweisen Bereitstellung einer neuen Softwareversion, bei der die Anwendung Server für Server oder Knoten für Knoten aktualisiert wird. Ziel ist es, eine kontinuierliche Verfügbarkeit der Anwendung während des Updates sicherzustellen, indem immer nur ein Teil der Infrastruktur aktualisiert wird, während der Rest weiterhin die alte Version verwendet.
Ein Rolling Deployment ist ideal für große, skalierbare Systeme, die eine kontinuierliche Verfügbarkeit erfordern, und reduziert das Risiko durch eine schrittweise Bereitstellung.
Blue-Green Deployment ist eine Methode zur Bereitstellung von Anwendungen, die dazu dient, Ausfallzeiten und Risiken während eines Software-Deployments zu minimieren. Es gibt dabei zwei nahezu identische Produktionsumgebungen, die als Blue und Green bezeichnet werden.
Blue-Green Deployment ist eine effektive Methode, um kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewährleisten und das Risiko von Störungen während eines Deployments zu reduzieren.